Zwei Häuser, gleich an Rang und Namen,
verdunkeln durch ihren langwährenden Hass und Groll
die Stadt Verona.
Den Feinden entspringt ein Liebespaar –
ihr Stern strahlt nur für kurze Zeit,
doch ihr Tod begräbt den alten Streit.
Alle Geschichten beginnen gleich –
Alle beginnen mit „es war einmal“ –
Hier jene von Romeo und Julia.[1]
Die berühmteste Liebesgeschichte der Welt fasziniert noch heute die Großen und die kleinen Großen.
Ein junger Mann und eine junge Frau, deren Herzen füreinander schlagen, gehören zwei verfeindeten Familien an. Ihre Liebe soll nicht sein und erwächst vielleicht gerade deshalb zu einem festen Band, das über all die Schranken hinweg Bestand hat und nicht mit dem tragischen Freitod der beiden Liebenden endet. Vielmehr werden ihre Liebe und damit auch sie durch den Tod unsterblich. Dies ist die Chance der Familien, sich zu versöhnen und dem Verlust der geliebten Kinder einen Sinn zu geben.
Das Drama von Shakespeare ist Pflichtlektüre in Klasse 9 im Deutschunterricht. Nun lässt sich über die Zeitgemäßheit der Lehrpläne streiten, ebenso darüber, ob die heutige Schülerschaft schon in Klasse 8 oder erst in Klasse 9 reif genug für dramatische Texte „Marke“ Shakespeare ist. Worüber aber Einigkeit herrscht, ist die Tatsache, dass irgendwann ein „A“ ein „B“ findet. Man sieht sich an, verliebt sich, möchte nicht nur Lippen miteinander teilen, meint füreinander bestimmt zu sein und es treten mitunter Schwierigkeiten auf. Das Motiv der unglücklich Verliebten ist so alt wie die Menschheit selbst. Nicht umsonst sind wir fasziniert von Julias Liebe zu Romeo, erschüttert über den sinnlosen Tod von Mercutio und Tybalt, außer uns, als die lebenswichtige Nachricht Romeo nicht rechtzeitig erreicht und ergriffen oder überwältigt vom Tod der Liebenden. Der Stoff gibt auch heute, etwa 400 Jahre nach der Uraufführung der Tragödie, Anlass in den Häusern der Kultur gespielt zu werden. So spielt auch das Volkstheater Rostock „Romeo und Julia“. Ein lohnender Theaterbesuch, würde man doch im Theater viel mehr als im „Buch“ verstehen, so die Schüler unserer 8. Klasse. Eine großartige Leistung der Schauspieler erwartete uns im Theaterzelt. Die Bühne ist schräg – in einem doppelten Sinn. Die Schauspieler tragen moderne Kleidung und die Sprache der Figuren ist dank der Übersetzung von Brasch in gewisser Weise zeitgemäß. Mit geistreichen Gags und Szenen, die an durchzechte Nächte im 21. Jahrhundert erinnern, aber auch den Missstand der Umgebung (Theaterzelt statt Großes Haus) auf die Schippe nehmen, unterhalten die Schauspieler über zwei Stunden ihr Publikum.
Ein Theaterstück sehen – Menschen sehen, die eine Rolle spielen, ohne special effects oder animierte Figuren, bildet uns. Nur die Bühne ermöglicht es dem Menschen, Zeuge einer Einzigartigkeit zu sein. Keine Aufführung gleicht der anderen. Kein Publikum gleicht dem anderen. Kein Moment kann nochmal erlebt werden. Theater ist das Zusammenwirken von Darsteller und Zuschauer. Jeder entscheidet für sich, Leerstellen zu füllen und Parallelen zu finden. Theater ist Kunst – soziale Kunst. Ins Theater gehen und Theater sehen leisten einen Beitrag zur ästhetischen Bildung unserer Kinder, der durch nicht ersetzt werden kann.
Der Link zu diesem Artikel lautet:
https://greenhouse-school.de/2012/05/30/romeo-und-julia/


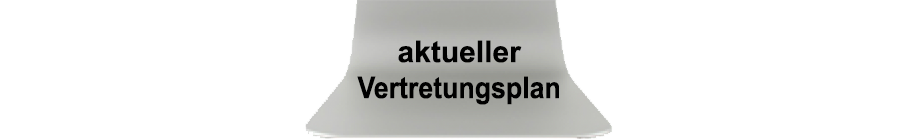
 © 2008-25 Greenhouse School
© 2008-25 Greenhouse School